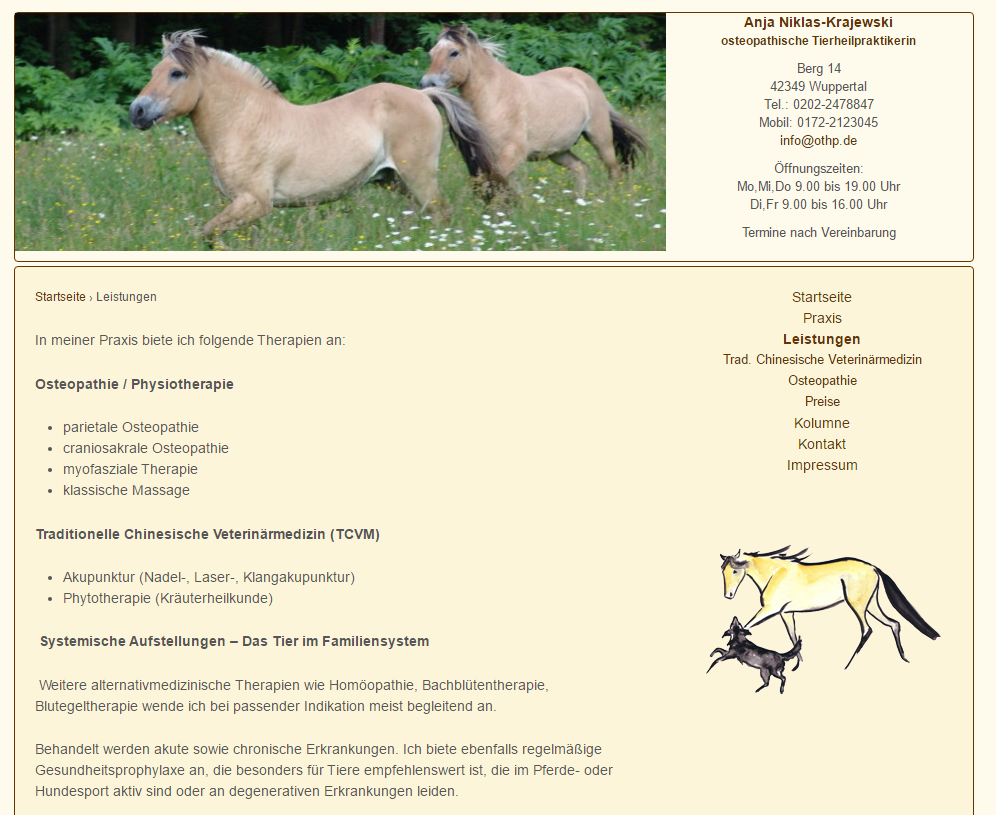Osteopathie – Pferdeosteopathie
Die Osteopathie am Pferd hat sich entwickelt, nachdem diese Therapie beim Menschen so gute Erfolge gezeigt hat.
Die Humanosteopathie wurde von Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917), einem amerikanischen Arzt begründet. Wegen schwerer familiärer Schicksalsschläge (er verlor fünf Kinder, sowie seine erste Ehefrau durch Krankheit) hinterfragte er immer öfter die klassische Medizin und stellte sich vor, dass der Körper des Menschen „eine göttliche Apotheke“ sei, die selbst über die nötigen Heilmittel verfüge.
Still war von der Mechanik begeistert. Er entwarf sogar selbst eine landwirtschaftliche Maschine. Schließlich übertrug er die Gesetze der Mechanik auf den Menschen. Das war der Anfang seiner neuen Betrachtungsweise. Er befand, dass Krankheit durch Störungen der mechanischen Strukturen des Menschen entsteht, also durch Blockaden im Bewegungsapparat.
Still behandelte seine Patienten durch Abtasten der Wirbelsäule und der Gelenke des Körpers. Fand er Blockaden oder Versteifungen, beseitigte er diese durch Druck, Zug und Mobilisation. Auf diese Weise verbesserte er nicht nur die Beweglichkeit der Patienten, sondern hatte auch Einfluss auf organische Erkrankungen, wie z.B. Magen-Darm-Erkrankungen, Asthma etc.
Die Osteopathie hatte große Heilerfolge in Amerika. Ein Schüler von ihm brachte 1917, dem Todesjahr Stills, die Osteopathie nach Europa. Er gründete die erste europäische Osteopathieschule in London.
1910 entwickelte der amerikanische Arzt Dr. Jim Atkinson die Chiropraktik, die sich von der Osteopathie dadurch unterscheidet, dass sie ausschließlich die Wirbelsäule behandelt.
Etwa um 1940 begannen die ersten Versuche, die Osteopathie aufs Tier zu übertragen. Es wurden Versuche mit Kaninchen und Hunden gemacht.
Der wirkliche Siegeszug der Veterinärosteopathie begann in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, als der französische Tierarzt Dr. Dominique Giniaux begann verstärkt Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Seitdem ist diese Therapieform „modern“ geworden.
Prinzipien der Pferdeosteopathie / Veterinär-Osteopathie
Die Pferdeosteopathie ist, wie auch die Homöopathie oder die traditionelle chinesische Medizin, eine ganzheitliche Heilmethode. Das heißt, das zu behandelnde Pferd wird als Ganzes betrachtet.
Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich „nur mal eben einen Wirbel einzurenken“. Da das ursächliche Problem nicht behoben ist, wird er in kürzester Zeit wieder blockieren.
Ein Osteopath kommuniziert mit dem Gewebe. Er tastet den gesamten Körper ab, prüft die Beweglichkeit jedes Gelenks, um so auf den Grund der Erkrankung zu stoßen.
„Nur die Gewebe wissen“
Rollin Becker, Osteopath
Für den Pferdeosteopathen ist es wichtig zu erkennen, auf welche Art und Weise sich Gelenke und Gewebe Ihres Pferdes bewegen.
Die Diagnose wird aufgrund der Beweglichkeit der Gewebe gestellt, die Therapie befasst sich mit der Unbeweglichkeit der Gewebe.
Zwingend notwendig für einen Pferde-Osteopathen sind daher umfassende Kenntnisse der Pferde-Anatomie, Physiologie, Pathologie und der Biomechanik des Pferdes.
Ablauf einer osteopathischen Behandlung
Erst einmal wird sich die Osteopathin/der Osteopath die Krankengeschichte des Pferdes anhören. Es wird notiert, welche Probleme das Pferd hat und Ihnen werden Fragen zu Reitweise, Haltung, Fütterung und Vorgeschichte des Pferdes gestellt.
Das zu behandelnde Pferd wird dann im Stand auf ebenem Boden betrachtet. Gibt es Asymmetrien in der Muskulatur oder in den knöchernen Strukturen? Allen Auffälligkeiten wird Beachtung geschenkt.
Auch die Zähne werden kontrolliert, denn durch Zahnprobleme entstehen häufig Blockaden im Genick oder der Halswirbelsäule.
Dann schaut sich die Osteopathin / der Osteopath das Pferd in der Bewegung an. Wenn es möglich ist, erst an der Hand, dann an der Longe und dann unterm Reiter.
Das Pferd wird von jeder Seite, von vorne und von hinten betrachtet um eine Ganganalyse zu erstellen.
Dabei kann es möglich sein, dass Sie das Pferd mehrfach hin und her führen müssen, da jedes Gelenk für sich auf seine korrekte Funktion hin beurteilt wird.
Große Aufmerksamkeit wird dem Hufbeschlag und dem Sattelzeug gewidmet.
Nun tastet die Osteopathin / der Osteopath das Pferd von Kopf bis Fuß ab (Palpation). Hierbei achtet sie/er auf die Beschaffenheit des Fells und der Haut, auf den Spannungszustand der Muskeln, auf Verhärtungen und Schmerzhaftigkeiten, auf vermehrte Wärme oder Kälte, auf die Verschiebbarkeit der Faszien, auf Narben, usw.
Schließlich wird jedes Gelenk auf seine Funktion getestet, indem es in alle, dem Gelenk möglichen Richtungen, bewegt wird. Beispielsweise hat das Schultergelenk die Fähigkeit zur Beugung, Streckung, Innenrotation, Außenrotation, Abstellung nach Außen (Abduktion) und Abstellung nach innen (Adduktion). Das Ellenbogengelenk ist jedoch nur zur Beugung und Streckung fähig.
Es werden immer die kontralateralen Gelenke verglichen. Wird zum Beispiel das rechte vordere Fesselgelenk getestet, vergleicht man die Beweglichkeit mit dem linken vorderen Fesselgelenk.
Die Beweglichkeit der Wirbelsäule wird häufig mit Hilfe von Therapiestäbchen überprüft. Das sollte sanft und mit auf die Empfindlichkeit des Pferdes angepasstem Druck geschehen. Vollblüter sind wesentlich empfindlicher wie z.B. Nordponys und reagieren schon auf leichten Fingerdruck. Nordponys sind „die Härtesten“ und reagieren häufig nur auf massiven Stäbchendruck, da sie gewohnt sind, Schmerzen und Unannehmlichkeiten erst einmal zu ignorieren. Der Stäbchentest darf dem Pferd keine Schmerzen bereiten!
Durch die Summe der Beobachtungen und Tests entsteht ein komplexes Bild der Bewegungsmöglichkeiten dieses Pferdes.
Jetzt löst die Pferde-Osteopathin / der Pferde-Osteopath die Blockaden in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit für den Bewegungsablauf. Viele kleinere Probleme verschwinden von selbst, wenn größere Blockaden gelöst sind.
In der Regel wird mit einer allgemeinen Mobilisation begonnen, bei der die Muskulatur gedehnt, und das betroffene Gelenk sanft bewegt wird. Sehr häufig ist nach dieser Behandlung das Problem schon verschwunden.
Weitere Möglichkeiten sind:
- diverse Muskeltechniken, wie das Dehnen (gegen die Läsion) oder das Entspannen (in Richtung der Läsion)
- Impulstechniken mit wenig Kraft, wenig Amplitude und hoher Schnelligkeit (niemals über die Bewegungsgrenzen des Gelenks hinaus)
- myotensive Techniken, bei denen man eine Spannung aufbaut und wartet, bis das Pferd das Gelenk selbst in Richtung der Läsion zieht
- weiche Gewebstechniken (Massage, Querfriktion)
- Faszientechniken
- energetische Techniken (Akupunktur, Akupressur, Kinesiologie usw.)
- aktive Bewegungstherapie (reiten, longieren, Cavalettiarbeit, etc.)
Die Manipulation sollte sanft vonstatten gehen! Völlig unnötig ist es, das Pferd aus dem Gleichgeweicht zu bringen, an den Beinen zu zerren, bis es irgendwo laut kracht oder dem Pferd Schmerzen zuzufügen!
Die Korrektur eines Gelenks kann ohne das geringste Knacken erfolgen!
Es ist sinnvoll, dass nach etwa 14 Tagen eine weitere osteopathische Untersuchung Ihres Pferdes folgt. Hierbei werden die behandelten Gelenke nachgetestet. Manchmal zeigen sich andere Probleme, die von den bei der ersten Behandlung gelösten Blockaden vorher überdeckt worden sind. Diese werden nun in der zweiten Sitzung behandelt.
Größere Probleme lassen sich häufig nur in mehreren Behandlungsgängen beheben.
Je nach Schwere der Läsionen wird die Osteopathin / der Osteopath mit Ihnen einen Therapieplan erstellen. Es kann möglich sein, dass das Pferd auf eine bestimmte Art longiert oder geritten werden muss.
Leider entstehen sehr viele Probleme durch nicht passendes Sattelzeug, falsches Reiten oder Longieren oder schlechte Haltungsformen. Hier ist Ihre Mitarbeit und Kooperation unglaublich wichtig! Wenn nichts an den Missständen geändert wird, kann jede osteopathische Behandlung nur kurzfristige Besserung bringen.
Was sind eigentlich Blockaden?
Stellen Sie sich unter „Blockaden“ keine ausgerenkten Gelenke oder Wirbel vor! Wäre das der Fall, könnte sich das Pferd vor Schmerzen gar nicht mehr bewegen oder wäre gelähmt.
Eine Blockade ist eine Bewegungseinschränkung innerhalb der physiologischen Bewegungsmöglichkeiten eines Gelenks oder Wirbels. Diese kann durch Spannungen der Gelenkkapsel, Verklebungen der Seitenbänder oder muskuläre Probleme verursacht werden.
Ein Brustwirbel hat zum Beispiel die Aufgabe in Facettengelenken zu gleiten. Biegt sich das Pferd nach links, gleiten die Wirbelkörper ein winziges Stück nach rechts um die Biegung nicht zu behindern. Dabei rotieren die Dornfortsätze ebenfalls etwas nach rechts.
Verspannt sich das Pferd in diesem Moment oder wirken Kräfte von außen ein, wie z. B. bei einem Sturz, kann es sein, dass ein oder mehrere Wirbel in der nach rechts verschobenen und rotierten Stellung verbleiben. Meist handelt es sich um Verschiebungen von nur wenigen Millimetern. Sehr häufig merkt der Reiter davon erst einmal nichts. Die Probleme entstehen aus der Schonhaltung, die das Pferd mit der Zeit einnimmt.
Auch in der Muskulatur können Blockaden entstehen. Ist ein Pferd beispielsweise noch nicht aufgewärmt und rutscht mit einem Bein weg, wird die Muskulatur dabei übermäßig gedehnt. Daraufhin erhöht der Körper den Tonus (die Anspannung) in den betroffenen Muskeln etwas, was natürlich zu Bewegungseinschränkungen führt (eine Muskelblockade).
Wird das nicht bemerkt, kann es zum „Muskelkettensyndrom“ kommen, wobei auch die Synergisten und Antagonisten der verkürzten Muskulatur leiden. Das Pferd wird immer verspannter laufen und evtl. schließlich an einer von der ursächlichen Verspannung weit entfernten Stelle lahm gehen.
Aus diesem Grund ist es auch so wichtig, das ganze Pferd zu behandeln und nicht nur das augenscheinliche Problem!
Ein Beitrag von A. Niklas-Krajewski
Osteopathischen Tierheilpraxis im Morsbachtal